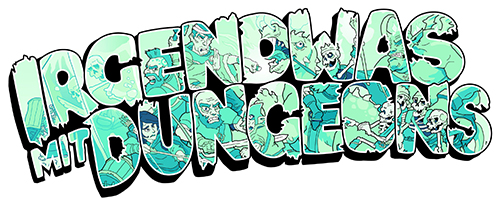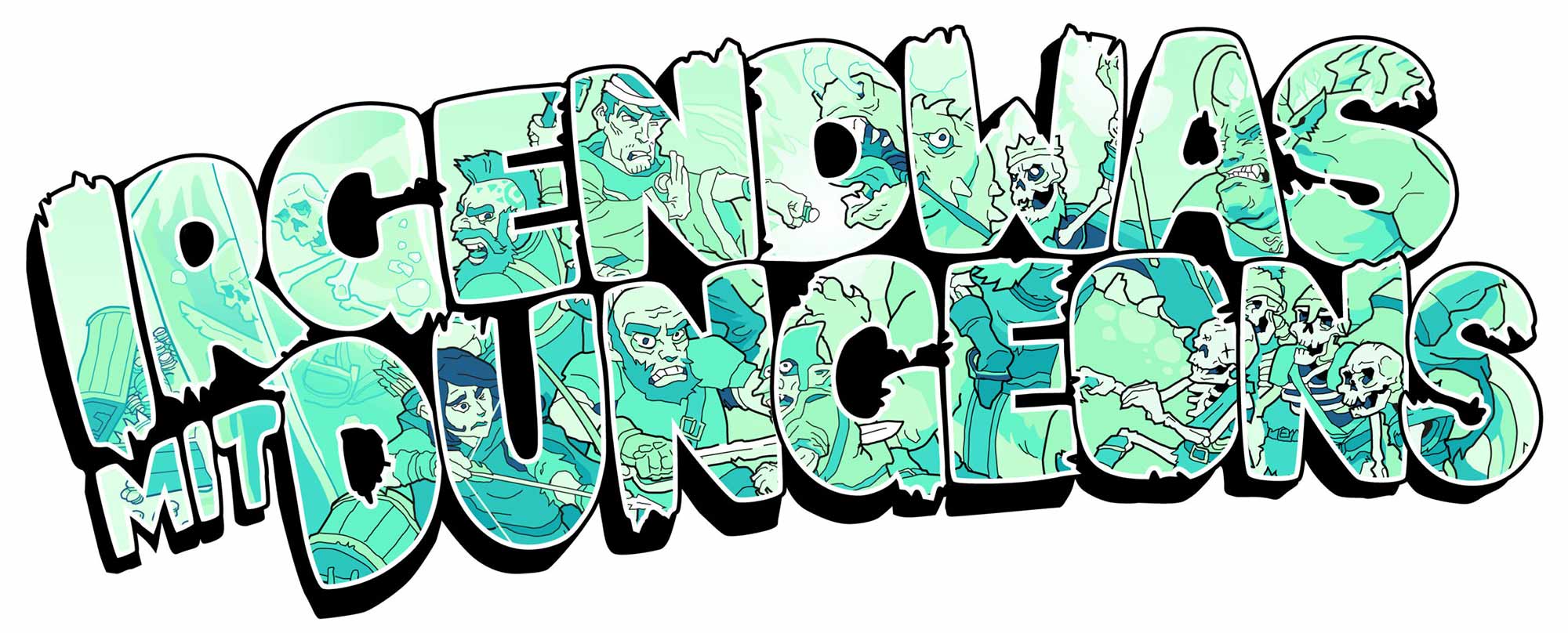Weird Games and Weirder People: Interview mit Harley Stroh
Harley Stroh ist zu Gast im Podcast Weird Games and Weirder People von Diogo Nogueira:
Harley Stroh, legendary RPG writer, Skate Punker, and an incredible Judge (or GM for the non-DCCers out there)! Author of moderns classics like Sailors of the Starless Sea, Doom of Savage Kings, Blades Against Death, Journey to the Center of Aereth, Tower of the Black Pearl, Peril on the Purple Planet, and more recently, the impressive The Music of the Spheres is Chaos, a massive boxed-set adventure with a spinning dungeon map! His work in the Dungeon Crawl Classics RPG line is super inspiring, and his adventures are some of my favorites of all time!
Hier zehn Gründe, warum man unbedingt diesen Podcast hören sollte. Punkt 7 hat mein Leben verändert und mich zum Weinen gebracht:
- Segler auf sternenloser See
- Der Fluch der Barbarenkönige
- Panik auf dem Purpurplaneten
- Reise zum Mittelpunkt der Aerde
- Der Turm der schwarzen Perle
- Der Juwelier, der mit Sternenstaub handelt
- The Music of the Spheres is Chaos
- Colossus Arise
- Schwerter gegen den Tod
- Beyond the Black Gate
Unübersetzbarer Gegenstand: Haftzettel
Der Haftzettel ist ein Pergament aus vorgöttlichen Zeiten, als die Magie noch roh und ungezügelt war. Magie musste erst auf Pergament, Steintafeln oder Papyrus gebannt und geformt werden. Heute gibt es nur noch 3W6 intakte Haftzettel auf der Welt und niemand besitzt mehr als einen dieser Zettel. In den längst vergangenen Tagen, als die Königreiche jung und gierig waren, wurden die Haftzettel gebraucht, um Dämonen, Nachtelfen und Zauberer einzukerkern. Diese Macht besitzt ein Haftzettel noch immer und nicht selten werden diese Zettel verwahrt, damit ein schrecklicher Feind nicht zurückkehren kann. Um ein Wesen einzukerkern muss der Haftzettel, der etwa die Größe einer Buchseite hat und heutzutage über und über mit Schriftzeichen bedeckt ist, auf den Körper des seines Opfers geklebt werden. Der wahre Name des Wesens erscheint dann augenblicklich auf dem Zettel, das Wesen verschwindet, der Haftzettel sinkt zu Boden und das Wesen ist solange gefangen, bis der Zettel zerstört oder sein Name durchgestrichen wird. Das Wesen altert nicht und nimmt die Welt um sich herum nicht wahr, es ist aus Raum und Zeit gefallen, bis es wieder zurück auf die materielle Ebene gebracht wird. Der Haftzettel ist ein mächtiges Artefakt, es ist aber folgendes zu beachten:
Um der Einkerkerung auf dem Haftzettel zu entgehen, kann das Opfer ein Willenskraft-RW mit einem Grundschwierigkeitsgrad von 5 ablegen. Dieser SG wird durch folgende Kriterien angepasst:
- Wesen ohne Wahren Namen können nicht mit einem Haftzettel eingekerkert werden.
- Wesen kann zaubern: +5 SG
- Wesen ist nicht auf der materiellen Ebene heimisch: +15 SG
- Haftzettel wird auf dem Kopf angebracht: -1W auf der Würfelkette für den Wurf (bzw. Rettungswurf wird mit Nachteil ausgewürfelt)
Treffen mehrere Kriterien zu (der zaubernde Dämon), wird der SG entsprechend modifiziert (der zaubernde Dämon müsste einen Wurf mit SG 25 ablegen).
Auf einem Haftzettel, der bis heute intakt geblieben ist, sind 1W100 Namen von eingekerkerten Wesen geschrieben. Sollte der Zettel zerstört werden, sind alle Kreaturen frei und schrecklich verärgert.
Making of Pentiment von Noclip
Sehenswerte Dokumentation über die Entstehung von Pentiment:
Rollenspielklausur 2024
Ich war unterwegs auf einer Rollenspielklausur. Ein paar Tage voller Rollenspiel und Gerede. Gespielt wurde:
Dungeon Crawl Classics: Die Masken von Lankhmar (als Test für eine Kurzdemo). Lief sehr gut und kann man demnächst auf den Conventions erleben.
Mythic Bastionland: Mit dem Riddle Knight, dem Path Knight und Barbed Knight. Es gab zwei Mythen The Pack und The Dead und wir haben die Toten erfolgreich bekämpft.
Dungeon Crawl Classics: Not in Kansas anymore. Ein Trichter mit SC aus den 1970er Jahren. Lief ausgezeichnet und gerade der Einstieg mit seltsamen Fantasynamen hat für Unterhaltung gesorgt.
Der Elefant im Porzellanladen oder die Abenteurergruppe im Magierturm
Ein Elefant richtet schnell kritischen Schaden in einem Porzellanladen an. Warum sollte das bei Abenteurern in einem Magierturm anders sein. Man denke nur an all die kostbaren, unersetzlichen, arkanen und vor allem zerbrechlichen Gegenstände, die sich im Labor einer Zaubererin befinden. Ein Schusswaffenduell im Maschinenraum der Roter Oktober oder ein Laserschwertgefecht in einem Atomkraftwerk lässt unsere actionverwöhnten Herzen höher schlagen, doch in Conan der Abenteurer (genauer gesagt in der Episode „Der geheimnisvolle Doppelgänger“), war der Kampf im Magierlabor ziemlich langweilig (was natürlich nicht überraschend ist, schließlich ist es Conan der Abenteurer – ein Mann, ein Freund, ein Held). Also dachte ich mir: Das kann man doch besser machen. Mit welchen Problemen könnte man also rechnen, wenn man sich mit schartigen Äxten, silbernen Zweihändern oder Feuerbällen im Studierzimmer eines Zauberers bekämpft? Hier wären 1W6 besonders zerbrechliche Gegenstände.
1 Sieben Beschwörungskerzen, angeordnet in einem Halbkreis zur Wand hin, halten ein Portal zur Hölle geschlossen. Erlischt eine Kerze oder wird der Halbkreis gebrochen, ist das Portal geöffnet. Es dauert 1W20 Runden, bis ein Teufel das Portal entdeckt hat.
2 Fünf Ampullen in allen Regenbogenfarben, die ein Farbenmeer ausgießen, wenn alle fünf Ampullen zerbrochen werden. Es strömen Tausende Liter Regenbogenwasser, die alles fortschwämmen und wem kein Zähigkeitswurf mit SG 10 gelingt, der verliert 1W6 Punkte Persönlichkeit (bzw. Charisma), weil er deutlich grauer und farbloser erscheint (was dem SC aber einen Bonus +1W auf Verstecken gibt).
3 Drei schwere Zauberbücher werden aus ihrem Schlaf geweckt. Sie flattern wie Vögel auf, erheben sich in die Lüfte und versuchen zu entkommen. Jedes von ihnen enthält einen kostbaren, neuen Zauberspruch.
4 Acht Glaskolben einer Alchemistenausrüstung, die ein Schlafgas erzeugen, wenn mehr als vier Glaskolben zerstört werden. Nur wem ein Willenskraftwurf mit SG 10 gelingt, schläft nicht ein.
5 Vier uralte Tontafeln, auf denen eine Dämonenschlacht im Abyss beschrieben wird. Wird eine Tafel zerstört, fallen 1W100 fingerhutgroße Dämonen (Spielwerte der Gruppe: 1 TW, AW 1W10, RK 8, 1W2 Schaden) heraus, die mehr ein Ärgernis als ein Problem darstellen.
6 Ein Smaragd- und Rubin-Schachspiel, das eine Partie zeigt, die seit 432 Jahren gespielt wird. Uschgal, der Gott der verschütteten Minen gewinnt die Partie gerade. Sollte das Spiel in Unordnung gebracht werden, wird Uschgal die Charaktere für den Rest seiner Existenz hassen.
SPAM-NSC: Klaudena

Swords & Wizardry: Eine Diebin, die man als Mietling anheuern kann und drei beliebige Schlösser öffnet oder Fallen entschärft. Sie nimmt aber niemals am Kampf teil und verlangt 1/4 von allen gefundenen Schätzen.
Beyond the Wall: Ein kleiner Dämon, der im Dorf sein Unwesen treibt und den Dorfschatz gestohlen hat.
Dungeon Crawl Classics: Eine außerdimensionale Diebin, die bei einem erfolgreichen Angriff keinen Schaden verursacht, sondern 1W4 Glück stiehlt.
Manche E-Mails im Spam-Ordner sind so kurios und absurd, dass sie die Kreativität anregen. Dies ist eine dieser E-Mails.
Drachenhorte
Denkt man an einen Drachen, so denkt man drei Atemzüge später an Gold. Gewaltige Schätze aus Münzen, Edelsteinen und Schmuckstücke bilden den Hort eines Drachen. Ist es nicht gerade diese Verlockung, die Abenteurer anlockt und sie dazu bringt ihr Leben zu riskieren? Natürlich gibt es auch edle Ritter, im Sinne eines Sir Lancelot oder Sir Tristan, die der Schreckensherrschaft des Drachen ein Ende bereiten wollen, für Ruhm und Ehre allein. Aber der Glanz des Goldes kann der größte Ansporn sein, um sein Leben zu riskieren.
Drachen und Gold
Es gibt eine Legende, dass die Anwesenheit eines Drachen erst dazu führt, dass ein so gewaltiger Goldschatz entsteht. Aus wenigen Münzen werden im Laufe der Jahre hunderte und tausende Goldstücke. Manche Könige könnten auf die Idee kommen Drachenjunge zu stehlen, um sie in die Schatzkammer zu werfen, damit der königliche Reichtum wächst. Natürlich werden dann, in einigen Jahren, Abenteurer oder geschickte Diebe nötig sein, um den Drachen zu überwinden, damit der Schatz geborgen werden kann. Manche Könige sollen auch Alchemisten anstellen, damit Drachen mit schweren Dämpfen in einem Tiefschlaf gehalten werden, so dass der Schatz beständig wachsen kann.
Drachen und Edelsteine
Eine andere Legende berichtet, dass Drachen durch Edelsteine spähen können. Durch diese kostbaren Steine beobachten sie die Welt und mehren ihr Wissen. All die Geheimnisse an den Königshöfen, all die romantischen Verwicklungen und die Dispute der Priester beobachten sie durch die Juwelen in den Kronen, Ringen und Insignien. Manche Drachen verschenken, in menschlicher Gestalt, sogar diese Steine in Form von Ringen oder Amuletten und manche Steine sollen es sogar erlauben, dass der Drache vom Geist dieser Menschen besitzergreifen kann.
Schätze im Drachenhort
Neben all dem Gold findet man in einem Drachenhort auch ungewöhnliche Schätze und magische Gegenstände. Um herauszufinden was für einen besonderen Schatz ein Drachentöter oder ein Dieb in einem Hort erbeuten kann, der kann mit einem W20 auf folgender Tabelle würfeln.
1W20 Schätze im Drachenhort
01 Die Überreste eines berühmten Ritters, dessen Angehörige auf Nachricht warten.
02 Die Krone eines vergessenen Königs, dessen Blutlinie nicht ausgestorben ist.
03 Die Mantelspange eines Elfenwaldläufers, der den Drachen verwundete und entkam.
04 Das Zauberbuch eines Magiers, der dem Drachen neue Opfer zuführt.
05 Das Amulett eines Zwergenpriesters, das dem Träger immer den Weg nach Norden weist.
06 Die Münze eines Reiches, das man nur in seinen Träumen erreichen kann.
07 Der Trank eines Alchemisten, der Immunität gegen Feuer gewährt.
08 Die Schreibfeder eines Priesters, durch die sich Verstorbene mitteilen können.
09 Die Harfe eines Barden, die richtig gespielt, jedermann Mut schenkt.
10 Der Hexenspiegel, der ihren Geist zeigt, der drei Fragen wahrheitsgemäß beantwortet.
11 Das Banner eines toten Königs, das alle Angst vertreibt.
12 Das Garnknäuel einer Jungfrau, das den Weg zu einem magischen Apfelbaum zeigt, dessen Früchte Wunden heilen.
13 Das Horn eines Dämons, der für 7 Jahre in der Schuld desjenigen steht, der ihm das Horn zurückbringt.
14 Die Stiefel eines Diebes, mit denen man sich lautlos bewegt.
15 Der Speer eines Mannes, der einen Gott damit verletzte, bis Blut die Spitze tränkte.
16 Das Schwert eines Kaisers, das davon besessen ist ein neues Imperium aufzubauen.
17 Die Trommel einer Druidin, die einen Riesenadler herbeirufen kann.
18 Der Geschichtenstab eines Barden, in welchem die Kindheitserinnerungen des Königs eingraviert sind, die er selbst vergessen hat.
19 Die schwarze Perle des Rabenkönigs, die es erlaubt mit Raben zu sprechen, wenn man sie selbst in den Mund nimmt.
20 Eine Flasche in der ein Engel gefangen ist, der nur in Gefangenschaft in jeder Nacht die Wunden heilt.
1W20 Abenteueraufträge
Für alle Abenteuerhungrigen 20 Einstiege in ein Abenteuer:
01 Findet den Alchemisten, der euch übers Ohr gehauen hat.
02 Überführt den wahren Mörder des erbarmungslosen Inquisitors.
03 Kartographiert den Berg ohne Wiederkehr.
04 Schlichtet die Fehde zwischen den vier Handelshäusern.
05 Haltet die alte Witwe auf und beendet die Kindesentführungen.
06 Findet heraus, was der Rote Priester gegenüber dem Patriarchen in der Hand hat.
07 Stehlt das Zepter der Mondpriesterin.
08 Entdeckt die geheimen Stätten des Blutkultes.
09 Bringt dem Erpresser das Lösegeld und findet heraus wer er ist.
10 Spielt eine Diplomatengruppe auf Baron Richards Fest.
11 Tötet den blinden Bettler ohne Spuren zu hinterlassen.
12 Stoppt die Mordserie an den Zwergen der Stadt.
13 Überzeugt den Bürgermeister eine Mauer zu bauen.
14 Findet ein Heilmittel für die sieben wahnsinnigen Priester.
15 Erforscht das violette Leuchten im Brunnenschacht.
16 Rüstet die Ritter für ihren Kampf gegen die Toten aus.
17 Vergrabt das Phylakterium tief im Wald, am Altar der Tiermenschen.
18 Klärt den Mord am Bäcker auf, der völlig blutleer aufgefunden wurde.
19 Sucht den Schatz im verfallenen Opernhaus.
20 Flieht aus dem Sumpfdorf bevor die Trommeln um Mitternacht schlagen.
Lesenswertes